Project
LiBaLu
Lithium-Batterien mit Luft/Sauerstoffelektrode
Duration | 01/01/2016 - 30/06/2019 |
Project management | Uni Bonn • MCTC • IPTC • EChemie |
City | Bonn |
Project participants | DLR • TT HS Offenburg Uni Münster • MEET VARTA Microbattery ZSW • StO Ulm |
Amount of funding | 2.578.025,00 € |
Total budget | no information |
Sponsor | BMFTR |
Description of the content of the joint project
Detailed description
Challenges and goals
Wiederaufladbare Lithium-Luft-Batterien stellen den Batterietyp mit der wohl größten theoretischen Energiedichte dar und würden einen Aktionsradius auch von batteriegetriebenen Kraftfahrzeugen von 500 km erlauben. Auch für die dezentrale, stationäre Energiespeicherung wäre ein solcher Typus einer Hochenergiebatterie ideal. In diesen dient an der positiven Elektrode bei der Entladung nicht mehr eine Schwermetallverbindung (wie in Lithium-Ionen-Batterien) als Oxidationsmittel, sondern der viel leichtere Sauerstoff, der zudem aus der Luft entnommen wird.
Allerdings sind die Grundlagenkenntnisse im Bereich elektrochemischer Reaktionen in den für Lithium-Batterien notwendigen nichtwässrigen Elektrolyten trotz der hervorragenden Performance von Lithium-Ionen-Batterien noch mangelhaft. Insbesondere die Sauerstoffreduktion und die anschließend bei der Wiederaufladung erfolgende Sauerstoffentwicklung stellen eine große Herausforderung für die Elektrodenmaterialien und die Elektrolyte dar. Ziel dieses Vorhabens ist es, die Lücken bei den Grundlagenkenntnissen zu schließen und aufgrund eines besseren Verständnisses Strategien für die Realisierung von Lithium-Luft/Sauerstoff-Batterien zu entwickeln. Die Realisierbarkeit soll anhand einer Prototypzelle demonstriert werden.
Content and focus of work
Gearbeitet werden soll in diesem Verbund einerseits an einem Batterietyp mit organischem Elektrolyten. Es kann sich dabei als sinnvoll erweisen, die Lithiumelektrode durch eine lithiumionenleitende Membran vor Reaktionen mit von der Luftelektrode stammendem Sauerstoff zu schützen. Andererseits soll auch versucht werden, mit wässrigen, alkalischen Elektrolyten zu arbeiten. Dabei sind die erreichbaren Stromdichten wesentlich höher, aber auch die Anforderungen an die Stabilität der Membran sind größer.
Es soll weiter eruiert werden, ob sich die Vorteile beider Konzepte kombinieren lassen, indem ein organischer Elektrolyt verwendet wird (mit der Folge einer höheren Stabilität der Membran), der aber genügend Wasser enthält, um die Reaktion ähnlich schnell wie in wässrigem Elektrolyten ablaufen zu lassen. Wesentlich für den Erfolg des Projekts ist die Entwicklung verbesserter Elektrodenmaterialien (Katalysatoren) und Elektrolytsysteme sowie der Membran.
Die Expertise der Partner im Verbund ergänzen sich hervorragend, um die komplexen Aufgaben zu lösen: Das ZSW verfügt über eine breite Kompetenz im Bereich klassischer Lithium-Ionen-Systeme und wird Erfahrungen mit organischen Elektrolyten in das Konsortium einbringen. Die Universität Münster verfügt ebenfalls über eine enorme Kompetenz im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien und hat große Erfahrungen in der Herstellung der lithiumionenleitenden Membranen. Bei der DLR gibt es langjährige Erfahrungen in der Herstellung und Charakterisierung von Katalysatoren nach jeweils unterschiedlichen Verfahren und in der Präparation von Gasdiffusionselektroden. An der Universität Bonn stehen spezielle Methoden der Oberflächenanalytik und zur Charakterisierung von Reaktionsprodukten zur Verfügung. An der Hochschule Offenburg steht ein Experte für die Modellierung der Vorgänge in den Batteriezellen zur Verfügung. Varta Microbattery ist der Batteriehersteller im Consumerbereich und wird im Projekt die Demonstratorzelle realisieren.
Assoziierte Partner sind die Firma Bayer Material Science (ausgewiesen in der Herstellung großtechnischer Gasdiffusionselektroden), die entsprechende Zellkomponenten einbringen wird und die Firma Schott, die in allen Bereichen von Glaskeramiken ausgewiesen ist und die Materialien für die Membran zur Verfügung stellen wird. Die Partner haben auch in vorausgegangenen Verbundvorhaben schon erfolgreich zusammengearbeitet, die Zusammenführung der Kompetenzen und Erfahrungen stellt auch hier eine ideale Basis für den Erfolg dieses Vorhabens dar.
Utilization of the results and contribution to energy storage
Im Erfolgsfall stünde langfristig ein neuer Typ von wiederaufladbarer Batterie sowohl für die Elektromobilität als auch für die dezentrale, stationäre Energiespeicherung zur Verfügung. Für eine sehr breite Nutzung elektrochemischer Energiespeicher ist dabei die Verfügbarkeit der eingesetzten Materialien wichtig: relativ teure Schwermetalle wie Cobalt werden allenfalls in geringen Mengen als Katalysator, nicht aber als Kathodenmaterial selbst benötigt.
Auch für andere Batterietypen wie Natrium-Luft- oder Lithium-Schwefel-Batterien sind die hier erarbeiteten Ergebnisse wichtig. Mittelfristig führen die in diesem Verbund erwarteten Erkenntnisse auch zu einer Verbesserung der Eigenschaften anderer Batterietypen, die sich im Prinzip schon in einem weiteren Entwicklungsstadium befinden wie Zink-Luft-Batterien. Aber auch Brennstoffzellen oder Sensoren könnten mittelfristig stark von den hier zu erwartenden Erkenntnissen profitieren mit der Folge erhöhter Marktchancen.
Kurzfristig können die Erkenntnisse etwa im Rahmen von kleinen Knopfzellen (z. B. Hörgerätebatterien) genutzt werden oder zur Verbesserung der Kathoden in der Chlor-Alkali-Elektrolyse. Erkenntnisse zur Stabilität aprotischer Elektrolyte würden auch vorteilhaft für die Erforschung von Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterien sein.
Project partners
Sub-project 1
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029A
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Abteilung Elektrochemie
Römerstr. 164
53117 Bonn
DE
Sub-project 2
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029B

Sub-project 3
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029C
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Technische Thermodynamik
Pfaffenwaldring 38 – 40
70569 Stuttgart
DE

Sub-project 4
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029D
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Standort Ulm
Helmholtzstr. 8
89081 Ulm
DE

Sub-project 5
Duration:
01/01/2016 - 31/12/2018
Funding code:
03XP0029E
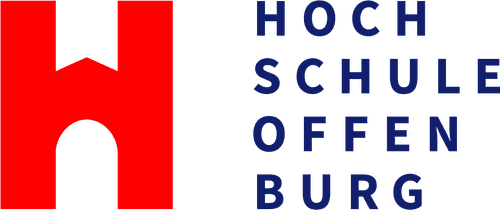
Sub-project 6
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029F
Universität Münster
MEET - Münster Electrochemical Energy Technology
Corrensstr. 46
48149 Münster
DE


Funding
Sponsor:
Project management agency (governmental):
Profile of funding:
Technologie- und Innovationsförderung
Type of funding:
PDIR
Systematic nature of the performance plan:
KB2220 Li-Ionen-Batterien
This project is part of the funding initiative

Joint-project management
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Abteilung Elektrochemie
Römerstr. 164
53117 Bonn
DE
