Project
LiBaLu
Lithium-Batterien mit Luft/Sauerstoffelektrode
Duration | 01/01/2016 - 30/06/2019 |
Executing unit | VARTA Microbattery |
City | Ellwangen (Jagst) |
Amount of funding | 314.718,00 € |
Total budget | no information |
Sponsor | BMFTR |
Content description of the sub-project
Brief description
Materialintegration und Zelldesign
computergestütztes Elektroden- und Zelldesign
Elektrodenkonzepte für organische Elektrolyte
Herstellung von Elektroden in Zielgröße
Skalierbarkeit bei der Herstellung
Up-scaling-Konzept und Bau einer Demonstratorzelle
Erforschung der Luftkathoden, durch Variation der Dicke, Hydrophobie, Beschichtung und Katalysatorauswahl
Bau einer Demonstratorzelle mit den besten erforschten Parametern
Validierung der Ergebnisse
Erforschung der Volumeneffekte beim Laden und Entladen
Detailed description
Challenges and goals
Wiederaufladbare Lithium-Luft-Batterien stellen den Batterietyp mit der wohl größten theoretischen Energiedichte dar und würden einen Aktionsradius auch von batteriegetriebenen Kraftfahrzeugen von 500 km erlauben. Allerdings haben sich die ursprünglichen Hoffnungen auf schnell realisierbare Hochenergiebatterien nach diesem Prinzip trotz intensiver Bemühungen nicht erfüllt. Ursache sind die noch mangelhaften Grundlagenkenntnisse zu elektrokatalytischen Reaktionen in den für Lithium-Batterien notwendigen nichtwässrigen Elektrolyten. Andererseits gab es in den vergangenen Jahren – auch in den Arbeiten der in diesem Verbund beteiligten Partner – interessante Fortschritte hinsichtlich der erreichten Zyklenzahl und Stromdichte, die eine technisch-industrielle Realisierung möglich erscheinen lassen.
Ziel dieses Vorhabens ist es, die Lücken bei den Grundlagenkenntnissen zu schließen und Strategien für die Realisierung von Lithium-Luft/Sauerstoff-Systemen zu entwickeln. Die Realisierbarkeit soll anhand einer Prototypzelle demonstriert werden.
Gearbeitet werden soll in diesem Verbund einerseits an dem mit einem rein organischen, aprotischen Elektrolyten arbeitenden Batterietyp. Es kann sich dabei als sinnvoll erweisen, die Lithiumelektrode durch eine lithiumionenleitende Membran vor Reaktionen mit von der Luftelektrode stammenden Sauerstoff zu schützen. Andererseits soll auch versucht werden, mit wässrigen, alkalischen Elektrolyten zu arbeiten. Dabei sind die erreichbaren Stromdichten wesentlich höher, aber auch die Anforderungen an die Stabilität der Membran sind größer.
Es soll weiter eruiert werden, ob sich die Vorteile beider Konzepte kombinieren lassen, indem ein organischer Elektrolyt verwendet wird (mit der Folge einer höheren Stabilität der Membran), der aber genügend Wasser enthält, um die Reaktion ähnlich schnell wie in wässrigem Elektrolyten ablaufen zu lassen. Wesentlich für den Erfolg des Projekts ist die Entwicklung verbesserter Elektrodenmaterialien (Katalysatoren) und Elektrolytsysteme sowie der Membran.
Content and focus of work
Einige sehr wichtige Aspekte konnten im Rahmen des Vorgängerprojekts GLANZ nicht erforscht werden. Dazu gehören:
• reversible Sauerstoffelektrode,
• Gasversorgung, speziell gezielte Einstellung der Druckverhältnisse,
• Kontaktierung der Kathode.
Ferner haben sich in der Zwischenzeit Alternativen für das Kathoden-Substrat und die bifunktionalen Katalysatoren ergeben, die auch erforscht werden sollen. Diese Aspekte werden in LiBaLu erforscht.
Als Ergebnis des Projekts wird eine funktionstüchtige Lithium-Luft-Zelle gezeigt, die skalierbar ist. Ferner werden alle Zusammenhänge für die Realisierung klar erfasst sein, sodass für die Verwertung Geschäftsmodelle erstellt werden können. Die Einsetzbarkeit wird für verschiedene Anwendungen geprüft und bewertet.
• Elektromobilität,
• stationäre Anwendungen,
• Kleinanlagen im Hausbereich,
• Netzunterstützung im Niedervoltnetz,
• Insellösungen für Betriebe mit hohem Stromverbrauch,
• Speicherung von regenerativer Energie an Windkraftanlagen.
Diese Bewertung kann als Grundlage weiterer Verwertungsansätze dienen.
Die Arbeitspakete sind:
Materialintegration und Zelldesign:
• Computergestütztes Elektroden- und Zelldesign (HSO): Es werden aus den Erfahrungen des Vorgängerprojekts GLANZ Erkenntnisse eingebracht.
• Evaluierung von Elektrodenkonzepten (Trennung von ORR und OER) für alkalischen Elektrolyt (DLR): Das Ergebnis wird eine klare Kategorisierung der Möglichkeiten sein, die bewertet wird. Diese bevorzugte Variante wird im finalen Demonstrator umgesetzt.
Up-Scaling-Konzept und Demonstratorzelle:
• Up-scaling und Bewertung der Kathodenherstellung in industrieller Umgebung (VMB 5 PM): Im Projekt werden Katalysatoren und Rezepturen zur Herstellung von bifunktionellen Elektroden entwickelt.
• Aufbau einer Demonstratorzelle und Validierung: In der letzten Phase sollen Elektroden und Zelle zu einer ersten Demonstratorzelle zusammengeführt werden und die Funktion des Verbundes validiert werden. Auch in diesem Arbeitspaket sollen die sollen die Elektroden aus dem Demonstrator durch Post-mortem Analyse charakterisiert werden.
Utilization of the results and contribution to energy storage
Die im Zusammenhang mit diesem Projekt erworbenen Kenntnisse können in vielfältiger Hinsicht verwandt werden.
• Für die Varta wird die Anwendung dieser Zellen im Bereich mobiler und stationärer Energiespeicherung mit Partner aus dem Bereich der EVU ins Auge gefasst (langfristig).
• Natürlich werden Erfahrungen, die im Bereich des momentanen Kerngeschäfts der Varta liegen, zur Verbesserung der Hörgerätezellen (momentan Zink/Luft primär) verwandt (kurzfristig).
Damit ergibt sich ein vielfältiger Nutzen aus diesem Projekt:
Die Kosten pro Kilowattstunde werden erwartungsgemäß wesentlich niedriger liegen als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Da kein teures Kathodenmaterial verwandt wird, werden Sie etwa 40 Prozent kostengünstiger sein. Natürlich hängt eine Investitionsentscheidung generell von einer ausführlichen Wirtschaftlichkeitsprüfung ab.
Das vorliegende Projekt wird aufgrund der Partnerstruktur zu erheblichen Synergien führen, da Firmen und Institute mit weltweit führender Positionierung zusammen operieren und somit die Führung etablieren.
Kurzfristig sind positive Auswirkungen bei schon bestehenden Produkten zu erwarten. Wenn es gelingt, die laufende Produktion von primären Zink/Luft-Knopfzellen (hier ist Varta Weltmarktführer) auf wieder aufladbare Zink/Luft-Knopfzellen umzustellen, hätte Varta weltweit ein Alleinstellungsmerkmal.
Mittelfristig können die Ergebnisse im Bereich der Kathode von großen Zink/Luft-Zellen eingesetzt werden. Diese haben als Zwischenspeicher bei
• Einfamilienhäusern und Wohnblocks,
• zur Netzunterstützung im Niederspannungsnetz,
• bis hin zur Abpufferung der Energien bei Windkraftanlagen
gute Chancen, da sie die Speicher kostengünstig (< 60 €/kWh) und umweltfreundlich machen. Im Vergleich zu Lithium/Luft gibt es dort wesentlich geringere Probleme, weshalb eine mittelfristige Umsetzung möglich erscheint.
Langfristig wird sich dann doch die Lithium/Luft-Zelle durchsetzen. Sie hat theoretisch eine ausreichend hohe Energiedichte, um ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug (EV) mit Reichweiten bis zu 500 km bei adäquaten Batterievolumen und Batteriegewicht darzustellen. Bei erfolgreichem Verlauf des Projektes und potenzieller Fahrzeugtauglichkeit dieses Batterietyps würde Deutschland als technischer Vorreiter auf diesem Gebiet gelten.
Project management as

Funding

Funding code: 03XP0029B
Sponsor:
Project management agency (governmental):
Profile of funding:
Technologie- und Innovationsförderung
Type of funding:
PDIR
Systematic nature of the performance plan:
KB2220 Li-Ionen-Batterien
This project is part of the joint project
Other sub-projects of the joint project
Sub-project 1
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029A
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Abteilung Elektrochemie
Römerstr. 164
53117 Bonn
DE
Sub-project 3
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029C
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Technische Thermodynamik
Pfaffenwaldring 38 – 40
70569 Stuttgart
DE

Sub-project 4
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029D
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Standort Ulm
Helmholtzstr. 8
89081 Ulm
DE

Sub-project 5
Duration:
01/01/2016 - 31/12/2018
Funding code:
03XP0029E
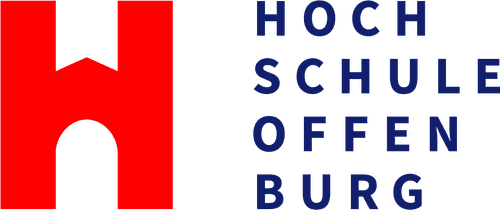
Sub-project 6
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029F
Universität Münster
MEET - Münster Electrochemical Energy Technology
Corrensstr. 46
48149 Münster
DE


This project is part of the funding initiative

Sub-project lead

Sub-project manager
Press contact
Joint-project management
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Abteilung Elektrochemie
Römerstr. 164
53117 Bonn
DE
