Projekt
LiBaLu
Lithium-Batterien mit Luft/Sauerstoffelektrode
Laufzeit | 01.01.2016 - 30.06.2019 |
Ausführende Stelle | DLR • TT |
Standort | Stuttgart |
Fördersumme | 506.128,00 € |
Projektvolumen | k. A. |
Fördergeber | BMFTR |
Inhaltliche Beschreibung des Teilprojektes
Kurzbeschreibung
Materialintegration und Zelldesign
Katalysatormaterialien für die Luftelektrode für das wässrige System
Herstellung von Elektroden in Zielgröße
Skalierbarkeit bei der Herstellung
Up-Skaling-Konzept und Bau einer Demonstratorzelle
Erforschung der Luftkathoden, durch Variation der Dicke, Hydrophobie, Beschichtung, Katalysatorauswahl
Bau einer Demonstratorzelle
Ausführliche Beschreibung
Herausforderungen Und Ziele
Wiederaufladbare Lithium-Luft-Batterien stellen den Batterietyp mit der wohl größten theoretischen Energiedichte dar und würden einen Aktionsradius auch von batteriegetriebenen Kraftfahrzeugen von 500 km erlauben. Allerdings haben sich die ursprünglichen Hoffnungen auf schnell realisierbare Hochenergiebatterien nach diesem Prinzip trotz intensiver Bemühungen nicht erfüllt. Ursache sind die noch mangelhaften Grundlagenkenntnisse zu elektrokatalytischen Reaktionen in den für Lithium-Batterien notwendigen nichtwässrigen Elektrolyten. Andererseits gab es in den vergangenen Jahren – auch in den Arbeiten der in diesem Verbund beteiligten Partner – interessante Fortschritte hinsichtlich der erreichten Zyklenzahl und Stromdichte, die eine technisch-industrielle Realisierung möglich erscheinen lassen.
Ziel dieses Vorhabens ist es, die Lücken bei den Grundlagenkenntnissen zu schließen und Strategien für die Realisierung von Lithium-Luft/Sauerstoff-Systemen zu entwickeln. Die Realisierbarkeit soll anhand einer Prototypzelle demonstriert werden.
Untersucht werden soll in diesem Verbund einerseits an dem mit einem rein organischen, aprotischen Elektrolyten arbeitenden Batterietyp. Es kann sich dabei als sinnvoll erweisen, die Lithiumelektrode durch eine Lithium-Ionen-leitende Membran vor Reaktionen mit von der Luftelektrode stammenden Sauerstoff zu schützen. Andererseits soll auch versucht werden, mit wässrigen, alkalischen Elektrolyten zu arbeiten; hier sind die erreichbaren Stromdichten wesentlich höher, aber auch die Anforderungen an die Stabilität der Membran sind größer. Es soll weiter eruiert werden, ob sich die Vorteile beider Konzepte kombinieren lassen, indem ein organischer Elektrolyt verwendet wird (mit der Folge einer höheren Stabilität der Membran), der aber genügend Wasser enthält, um die Reaktion ähnlich schnell wie in wässrigem Elektrolyten ablaufen zu lassen. Wesentlich für den Erfolg des Projekts ist die Entwicklung verbesserter Elektrodenmaterialien (Katalysatoren) und Elektrolytsysteme sowie der Membran.
Inhalt und Arbeitsschwerpunkte
Herstellung von Referenzelektroden und Auswahl einer Standardmesszelle und Synthese und Screening neuer binärer (bimetallischen) und ternärer Katalysatorkombinationen (DLR): In diesem Arbeitspaket sollen zu Beginn Elektroden mit Materialien aus dem Projekt „Strom aus Luft und Li“ am DLR hergestellt werden und für erste Charakterisierungen mit zyklischer Voltammetrie (CV) und elektrochemischer Impedanzspektroskopie (EIS) dienen. Diese Messungen sollen als Referenzmessung für alle später entwickelten Elektroden dienen. Zu Beginn dieses Arbeitspakets soll der Fokus auf einem Screening weiterer binärer oder ternärer Katalysatorsysteme liegen. Hier soll frühzeitig auch die Rückkopplung zu den Projektpartnern, welche für das Scale-Up verantwortlich gesucht werden. Weiter soll als Bestandteil dieser ersten Phase eine Standardmesszelle für den wässrigen Elektrolyten festgelegt werden. Für diese Standardmesszelle sollen durch Recherche sowohl kommerzielle als auch bereits in anderen Projekten eingesetzte Standardzellen durch erste Versuche auf ihre Eignung hin untersucht werden.
Herstellung und Test von neuen Elektroden mit neuen Leitzusätzen (Schwerpunkt leitfähige TiOx) (DLR, UB): Aufbauend auf die Erfahrungen aus dem „Strom aus Luft und Li“-Projekt, soll dann am DLR versucht werden, die seither verwendeten leitfähigen Metalle (Silber und Nickel), wenn möglich durch neue Materialien, wie etwa leitfähige Metalloxide (z. B. TiOx), zu ersetzen. Schwerpunkt der Untersuchungen soll hierbei auf leitfähigen Titanoxiden (z. B. Ti4O7 und dotierte Titanoxide) liegen, da neben den positiven Eigenschaften auch widersprüchliche Beobachtungen zur Stabilität dieser Materialien vorliegen. Weiter sollen aber auch Materialien wie Bor-dotierte Diamanten oder auch Titancarbide untersucht werden. Hier soll der Vergleich zum Referenzmaterial erfolgen. Neben der Eignung dieser Elektroden im wässrigen Elektrolyten soll auch ein Probenaustausch mit Projektpartnern mit organischem, aprotischem Elektrolyten erfolgen, um die Eignung in jeweils anderen Elektrolyten zu prüfen. In einem nächsten Schritt sollen neben Versuchen mit Sauerstoff auch Versuche mit synthetischer Luft als Testgas erfolgen. Zusätzlich sollen weitere Betriebsparametern (Temperatur, Konzentration des Elektrolyten, Sauerstoffpartialdruck) variiert werden, um einen noch stärkeren Bezug zu den realistischen Betriebsbedingungen herstellen. Für diesen Teil des Arbeitspakets sind 9 PM vorgesehen.
Austausch von Elektroden, Erprobung von Materialien der Projektpartner bei verschiedenen Betriebsparametern (DLR, UB): Innerhalb dieses Arbeitspakets sollen Elektroden der Projektpartner ausgetauscht werden. Dabei sollen sowohl Elektroden für das wässrige im aprotischen System sowie vom aprotischen im wässrigen System auf ihre Eignung untersucht werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit und durch Probenaustausch mit den vertretenen Projektpartnern. Eventuelle Vorteile von Elektroden/Elektrodenzusammensetzungen/Katalysatorsystemen sollen so frühzeitig erkannt werden und die Erkenntnisse in die weitere Entwicklung der Elektroden einfließen. Weiter sollen von Projektpartnern gelieferte Separatoren(-systeme) auf ihre Eignung untersucht und in Zellen eingebaut werden. Danach können an diesen Systemen Untersuchungen an den Grenzflächen auf Anoden- und Kathodenseite erfolgen. Einen wichtigen Teil stellt zudem die Post-mortem-Analyse der zyklierten Elektroden dar. Diese Analyse erfolgt durch am DLR verfügbare Methoden wie der Röntgendiffraktometrie (XRD), Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS), Raman-Spektroskopie oder mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM).
Organische Elektrolyte (zunächst an C und Au): Ziel ist der Aufbau einer Hybridzelle mit aprotischer, organischer Anode und wässriger Kathode.
Mischungen wässriger mit organischen Elektrolyten (UB, DLR, ZSW): In diesem Arbeitspaket soll zusammen mit UB und ZSW eruiert werden, ob sich in einem Hybridsystem die Luftelektrode die Vorteile des organischen Elektrolyten (höhere Stabilität der Membran) auf der Anodenseite mit den Vorteilen des wässrigen Elektrolyten auf der Kathodenseite (bekannte Katalyse, wesentlich höhere Stromdichten) kombinieren lassen. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes von wässrigem Elektrolyten auf der Kathodenseite gegenüber dem rein organischen Elektrolyten ist die Unempfindlichkeit gegen Luftfeuchte und die hohen erreichbaren Stromdichten des wässrigen Systems. Hier wäre alternativ nach einem organischen Lösemittel zu suchen, das auch in Anwesenheit von Wasser bei Potentialen der Sauerstoffentwicklung stabil ist. Dies ist auch eine Frage der Katalysatoren, die ähnlich wie im rein aprotischen System für die Sauerstoffentwicklung aktiv, bezüglich der Oxidation der organischen Komponente aber inert sein müssen.
Materialintegration und Zelldesign: Ziel ist die Evaluierung von alternativen Zellkonzepten mit getrennten Elektroden für ORR und OER, sowie Herstellung von Elektroden in Zielgröße.
Evaluierung von Elektrodenkonzepten (Trennung von ORR und OER) für alkalischen Elektrolyt (DLR): In einer ersten Phase soll im Rahmen dieses Arbeitspakets eine Evaluierung von weiteren, alternativen Zellkonzepten erfolgen. Insbesondere soll dabei die Möglichkeit der Trennung der Elektroden für die ORR und die OER und die Integration dieser Idee in das Zellkonzept überprüft werden. Eine Trennung der beiden Reaktionen an unterschiedlichen oder speziell für die jeweilige Reaktion aufgebauten Elektroden kann neben der Erhöhung der erreichten Stromdichten bei den jeweiligen Reaktionen und daher auch zu einer Lebensdauererhöhung und der Erhöhung der Kapazität führen.
Herstellung von Elektroden in Zielgröße, Skalierbarkeit bei der Herstellung (DLR, BMS): Nach Abschluss der ersten Phase soll in einer zweiten Phase zusammen mit BMS die Herstellung der benötigten Elektroden erfolgen. Wichtig herbei ist es, das Herstellverfahren so zu wählen, dass die Skalierbarkeit auf die Zielgröße möglich ist und zu reproduzierbaren Ergebnissen führt. Die Zielgröße wird in diesem Fall durch die Geometrie der Demonstratorzelle vorgegeben.
Up-Scaling-Konzept und Demonstratorzelle: Ziel ist der Aufbau einer Demonstratorzelle.
Aufbau einer Demonstratorzelle und Validierung (VMB, DLR).
Erforschung Gaszufuhr und Bau des finalen Demonstrators (VMB, DLR): In der letzten Phase sollen Kathoden des DLR zu einem ersten Demonstrator (VMB) zusammengeführt und die Funktion des Verbundes validiert werden. Auch in diesem Arbeitspaket sollen die Elektroden aus dem Demonstrator durch Post-mortem-Analyse charakterisiert werden. Die Untersuchungen werden mit der „blauen“ Zelle (aus GLANZ) mit verschiedenen Gasen durchgeführt (Luft, trockene synthetische Luft und trockener Sauerstoff). Sie dienen der Erforschung neuer Konzepte für die Abdichtung der Gaselektrode und der Luftaufbereitung. Dabei wird auf die Möglichkeit des Up-Scaling geachtet, sodass zum Schluss des Projekts ein Konzept für den Bau einer großflächigen Zelle zur Verfügung steht.
Spezifikation für die Anwendungen: Ziel ist das Bestimmen von Parametern für die Zielspezifikation.
Zielspezifikation bezüglich der Anwendung (VMB, DLR, ZSW, BMS): Aus der Anwendung heraus werden die Parameter für die Zielspezifikation bestimmt. Neben der Energie- und der Leistungsdichte werden Zielwerte für die Lebensdauer und die Kosten festgelegt. Für den Teilbereich des DLR ist hier 1 PM vorgesehen.
Resultierende Materialparameter (VMB, DLR, ZSW, BMS): Aus den zuvor festgelegten Werten werden Materialkombinationen ermittelt, mit denen die Zielspezifikation erreichbar erscheint. Diese werden im Folgenden detailliert erforscht.
Nutzung der Ergebnisse und Beitrag zur Energiespeicherung
Die im Zusammenhang mit diesem Projekt erworbenen Kenntnisse können in vielfältiger Hinsicht verwandt werden.
Im Erfolgsfall stünde langfristig ein neuer Typ von wiederaufladbarer Batterie sowohl für die Elektromobilität als auch für die dezentrale, stationäre Energiespeicherung zur Verfügung. Für eine sehr breite Nutzung elektrochemischer Energiespeicher ist dabei die Verfügbarkeit der eingesetzten Materialien wichtig: relativ teure Schwermetalle wie Cobalt werden allenfalls in geringen Mengen als Katalysator, nicht aber als Kathodenmaterial selbst benötigt. Auch für andere Batterietypen wie Natrium-Luft oder Lithium-Schwefel-Batterien sind die hier erarbeiteten Ergebnisse wichtig.
Mittelfristig führen die in diesem Verbund erwarteten Erkenntnisse auch zu einer Verbesserung der Eigenschaften anderer Batterietypen, die sich im Prinzip schon in einem weiteren Entwicklungsstadium befinden wie Zink-Luft Batterien. Aber auch Brennstoffzellen oder Sensoren könnten mittelfristig stark von den hier zu erwartenden Erkenntnissen profitieren mit der Folge erhöhter Marktchancen.
Kurzfristig können die Erkenntnisse z. B. im Rahmen von kleinen Knopfzellen (z. B. Hörgerätebatterien) genutzt werden oder zur Verbesserung der Kathoden in der Chlor-Alkali-Elektrolyse. Erkenntnisse zur Stabilität aprotischer Elektrolyte würden auch vorteilhaft für die Erforschung von Hochvolt.Lithium-Ionen-Batterien sein.
Die Ziele des DLR innerhalb LiBaLu sind im Speziellen:
• Verbesserung des Verständnis der Wirkungsweise verwendeter binärer, bifunktioneller Katalysatoren für die Sauerstoffentwicklung (OER) bzw. Sauerstoffreduktion (ORR),
• Herstellung und Charakterisierung von neuen binären oder tertiären Katalysatoren mit hoher elektrokatalytischer Aktivität und Langzeitstabilität unter den Betriebsbedingungen, Klassifizierung und Auswahl geeigneter Katalysatoren,
• Herstellung und Charakterisierung von bifunktionellen Elektroden mit weiter reduzierten Überspannungen (Spannungsdifferenz zwischen Laden/Entladen < 1,5 V) bei gleichen realisierten Stromdichten durch Einsatz geeigneter (neuer) Elektrodenkomponenten mit optimaler Struktur für den Betrieb mit wässrigem Elektrolyten,
• Herstellung einer Zelle mit einem Hybrid-Elektrolyt-System mit einem wässrigen alkalischen Elektrolyten auf der Kathoden-/Luftseite und einem aprotischen Elektrolyten auf der Li-Metall- bzw. Anodenseite.
Projektbetreuung als
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Technische Thermodynamik
Pfaffenwaldring 38 – 40
70569 Stuttgart
DE

Förderung

Förderkennzeichen: 03XP0029C
Fördergeber:
Projektträger:
Förderprofil:
Technologie- und Innovationsförderung
Förderart:
PDIR
Leistungsplansystematik:
KB2220 Li-Ionen-Batterien
Dieses Projekt ist Teil des Verbundprojekts
Weitere Teilprojekte des Verbundvorhabens
Teilprojekt 1
Laufzeit:
01.01.2016 - 30.06.2019
Förderkennzeichen:
03XP0029A
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Abteilung Elektrochemie
Römerstr. 164
53117 Bonn
DE
Teilprojekt 2
Laufzeit:
01.01.2016 - 30.06.2019
Förderkennzeichen:
03XP0029B

Teilprojekt 4
Laufzeit:
01.01.2016 - 30.06.2019
Förderkennzeichen:
03XP0029D
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Standort Ulm
Helmholtzstr. 8
89081 Ulm
DE

Teilprojekt 5
Laufzeit:
01.01.2016 - 31.12.2018
Förderkennzeichen:
03XP0029E
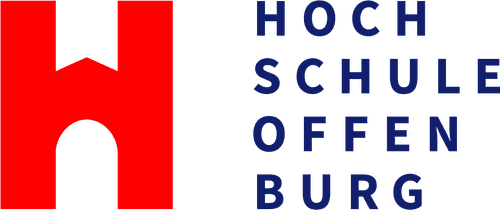
Teilprojekt 6
Laufzeit:
01.01.2016 - 30.06.2019
Förderkennzeichen:
03XP0029F
Universität Münster
MEET - Münster Electrochemical Energy Technology
Corrensstr. 46
48149 Münster
DE


Dieses Projekt ist Teil der Förderinitiative

Batterie 2020 (Transfer)
Batteriematerialien für zukünftige elektromobile, stationäre und weitere industrierelevante Anwendungen
Teilprojektleitung
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Technische Thermodynamik
Pfaffenwaldring 38 – 40
70569 Stuttgart
DE

Teilprojektleiter*in
Pressekontakt
Herr
Verbundprojektkoordination
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Abteilung Elektrochemie
Römerstr. 164
53117 Bonn
DE
