Project
LiBaLu
Lithium-Batterien mit Luft/Sauerstoffelektrode
Duration | 01/01/2016 - 30/06/2019 |
Executing unit | Uni Bonn • MCTC • IPTC • EChemie |
City | Bonn |
Amount of funding | 625.035,00 € |
Total budget | 625.035,00 € |
Sponsor | BMFTR |
Content description of the sub-project
Detailed description
Challenges and goals
Für eine zukünftige nachhaltige Energieversorgung und die Elektrotraktion müssen neuartige Hochenergiespeichersysteme entwickelt werden. Eine der zentralen Möglichkeiten sind wiederaufladbare Batterien. Theoretisch bieten Lithium-Luft-Batterien ein sonst mit Batterien nicht zu erreichende Energiedichte.
Die anfänglichen Hoffnungen auf schnell realisierbare Hochenergiebatterien nach diesem Prinzip haben sich trotz der intensiven Entwicklungsarbeiten bisher aber nicht erfüllt. Dies hängt ursächlich damit zusammen, dass im Kontakt mit Lithiummetall anstelle wässriger Elektrolyte ein organischer Elektrolyt verwendet werden muss, aber Grundlagenuntersuchungen zu elektrokatalytischen Reaktionen wie der Sauerstoffreduktion (ORR) bzw. -entwicklung (OER) in solchen organischen Elektrolyten in der Vergangenheit kaum durchgeführt wurden. Die einzelnen Reaktionsschritte und deren Beeinflussung durch Elektrodendesign, Katalysatorwahl und Elektrolyt sind im Detail bisher nicht verstanden. Bisher ungelöste Probleme sind u. a.:
• die schlechte Reversibilität der Sauerstoffreduktion,
• mögliche Nebenreaktionen des organischen Elektrolyten,
• Blockade der Elektrodenoberfläche oder Verstopfung der Poren durch Lithiumperoxid oder anderen in Nebenreaktionen gebildeten Feststoffen.
Diese Probleme führen auch zu einer verhältnismäßig schlechten Reproduzierbarkeit von Ergebnissen aus der Literatur. Publizierte Daten nicht nur zu Kapazitäten, Leistungsdichten und Zyklenstabilitäten scheinen stark vom individuellen experimentellen Aufbau abzuhängen, sondern auch Ergebnisse im Bereich der Grundlagenuntersuchungen.
Ziel des hier beschriebenen Teilvorhabens ist es, diese Probleme anzugehen und die zur Lösung notwendigen Grundlagen zu erarbeiten. Ein besseres Verständnis soll es dann den Partnern ermöglichen, Strategien für die Realisierung solcher Lithium-Luft-Batterien zu entwickeln.
Content and focus of work
Konkret sollen in diesem Teilprojekt die folgenden grundlegenden Untersuchungen im Hinblick auf Lithium-Luft/Sauerstoff-Batterien durchgeführt werden:
a) aprotischer Elektrolyt: Hier sollen insbesondere verbesserte, stabilere Elektrolytsysteme und Elektrodenmaterialien, die die OER und ORR nach Möglichkeit katalysieren (aber nicht die Elektrolytzersetzung) und die Keimbildung von Lithiumperoxid positiv beeinflussen, identifiziert und detailliert charakterisiert werden. Der Einsatz von Redoxmediatoren wird ebenfalls untersucht. Ziel ist, ein maßgeschneidertes Elektroden/Elektrolyt-Konzept für hohe Entladekapazitäten, schnelle Kinetik und gute Langzeitstabilität zu entwickeln.
b) wässriger Elektrolyt mit Trennung der Elektroden durch eine ionenleitende Festkörpermembran: Parallel wird an einem Zellkonzept gearbeitet, bei dem auf der positiven Seite ein alkalischer Elektrolyt verwendet wird und die Lithiumelektrode durch eine Membran geschützt wird. Durch Verwendung geeigneter bifunktioneller Katalysatoren, wie sie im Vorhaben „LuLi“ entwickelt wurden, lassen sich hohe Stromdichten sowohl für die Sauerstoffreduktion als auch für die Sauerstoffentwicklung realisieren.
c) Mischungen wässriger mit organischen Elektrolyten: Im Projekt wird erarbeitet, inwieweit die beiden oben genannten Konzepte kombiniert werden können. Entwickelt wird ein System, das an der Luftelektrode mit Mischungen aus wässrigen und organischen Elektrolyten arbeitet. Bei genügend niedrigem Wasseranteil sollte die Membran deutlich stabiler sein, andererseits sollte die Sauerstoffreduktion und -entwicklung ähnlich wie in wässrigen Systemen mit dem Vorteil der bekannten, schnelleren Katalyse und des 4-Elektronentransfers ablaufen. Hier ist der optimale Wassergehalt zu eruieren, und zwar unter Berücksichtigung der Membranstabilität einerseits und des Einflusses auf die Sauerstoffreduktion bzw. -entwicklung andererseits.
Utilization of the results and contribution to energy storage
Im Erfolgsfall stünde langfristig ein neuer Typ von wiederaufladbarer Batterie sowohl für die Elektromobilität als auch für die dezentrale, stationäre Energiespeicherung zur Verfügung. Für eine sehr breite Nutzung elektrochemischer Energiespeicher ist dabei die Verfügbarkeit der eingesetzten Materialien wichtig: relativ teure Schwermetalle wie Cobalt werden allenfalls in geringen Mengen als Katalysator, nicht aber als Kathodenmaterial selbst benötigt.
Auch für andere Batterietypen wie Natrium-Luft- oder Lithium-Schwefel-Batterien sind die hier erarbeiteten Ergebnisse wichtig. Mittelfristig führen die in diesem Verbund erwarteten Erkenntnisse auch zu einer Verbesserung der Eigenschaften anderer Batterietypen, die sich im Prinzip schon in einem weiteren Entwicklungsstadium befinden wie Zink-Luft-Batterien. Aber auch Brennstoffzellen oder Sensoren könnten mittelfristig stark von den hier zu erwartenden Erkenntnissen profitieren mit der Folge erhöhter Marktchancen.
Kurzfristig können die Erkenntnisse etwa im Rahmen von kleinen Knopfzellen (z. B. Hörgerätebatterien) genutzt werden oder zur Verbesserung der Kathoden in der Chlor-Alkali-Elektrolyse. Erkenntnisse zur Stabilität aprotischer Elektrolyte würden auch vorteilhaft für die Erforschung von Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterien sein.
Project management as
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Abteilung Elektrochemie
Römerstr. 164
53117 Bonn
DE
Funding

Funding code: 03XP0029A
Sponsor:
Project management agency (governmental):
Profile of funding:
Technologie- und Innovationsförderung
Type of funding:
PDIR
Systematic nature of the performance plan:
KB2220 Li-Ionen-Batterien
This project is part of the joint project
Other sub-projects of the joint project
Sub-project 2
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029B

Sub-project 3
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029C
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Institut für Technische Thermodynamik
Pfaffenwaldring 38 – 40
70569 Stuttgart
DE

Sub-project 4
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029D
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Standort Ulm
Helmholtzstr. 8
89081 Ulm
DE

Sub-project 5
Duration:
01/01/2016 - 31/12/2018
Funding code:
03XP0029E
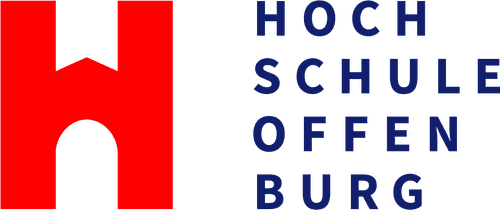
Sub-project 6
Duration:
01/01/2016 - 30/06/2019
Funding code:
03XP0029F
Universität Münster
MEET - Münster Electrochemical Energy Technology
Corrensstr. 46
48149 Münster
DE


This project is part of the funding initiative

Sub-project lead
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Abteilung Elektrochemie
Römerstr. 164
53117 Bonn
DE
Sub-project manager
Press contact
Joint-project management
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Abteilung Elektrochemie
Römerstr. 164
53117 Bonn
DE
