Project
LISZUBA
Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien als Zukunftsbatterie
Duration | 01/07/2017 - 31/12/2020 |
Executing unit | JLU • PhysChem |
City | Gießen |
Amount of funding | 437.653,00 € |
Total budget | 437.653,00 € |
Sponsor | BMFTR |
Content description of the sub-project
Brief description
elektrochemische Evaluation von Feststoffbatterien mit Schwefel-Kohlenstoff-Kathoden
Untersuchung des Grenzflächentransportes und der mechanischen Eigenschaften in Oxid-Sulfid-Festelektrolyt-Kompositen
Assemblierung und Optimierung einer festen Kathoden Halbzelle
Evaluation der geeignetsten Komponenten für die Kathode
Detailed description
Challenges and goals
Leistungsfähige, sichere Batterien können der Elektromobilität zum konsequenten Durchbruch verhelfen da vollelektrische Fahrzeuge mit hoher Sicherheit, Reichweite und langer Lebensdauer attraktiv für den Endverbraucher sind. Die Lithium-Ionen-Technik ist hinsichtlich der erreichbaren Energiedichten bereits weit entwickelt, deckt aber noch nicht die aktuellen Anforderungen ab. Daher müssen neue Zellkonzepte systematisch erforscht werden. Wichtig ist dabei, zukünftige Zellkonzepte schon von Anfang an auf ihren optimalen und effizienten Verwendungszweck zu untersuchen.
Einerseits versprechen Ansätze wie Lithium-Schwefel- (Li-S-), aber auch Lithium-Festkörper-Batterien (Li-ASB) deutlich höhere Kapazitäten. Eine Li-S-Batterie mit einer Lithium-Metall-Anode weist hierbei hohe theoretische Kapazitäten von 2.800 Wh/L bzw. 2.500 Wh/kg auf. Im Vergleich dazu stellen aktuelle Lithium-Ionen-Batterien praktische Energiedichten von ca. 270 Wh/kg auf Zellebene bereit. Andererseits ist der Einsatz einer Li-ASB mit höherer Sicherheit, bei ggf. sogar niedrigeren Kosten, verbunden, da diese auslaufsicher und hochtemperaturstabil sind.
Ziel des Projektes ist es deshalb, eine Lithium-Schwefel-Feststoffbatterie zu entwickeln. Hierbei werden die Konzepte der Lithium-Schwefel-Batterie und der Feststoffbatterie kombiniert und die spezifischen Probleme beider „Muttertechnologien“ gezielt durch die Stärken der jeweils anderen kompensiert werden. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen letztlich Energie- und Leistungsdichte, Degradationsverhalten sowie Prozessierbarkeit für eine industrierelevante Hochskalierung.
Content and focus of work
Die in LISZUBA geplanten Arbeiten adressieren die Herausforderungen der Li-S-Zellen mit Flüssigelektrolyten. Es soll im Rahmen des Projektes eine Li-S-Feststoffbatterie entstehen, die einen neuartigen Zellaufbau besitzt und diese Problemstellungen minimiert bzw. eliminiert, indem mit zwei verschiedenen Festelektrolytkomponenten gearbeitet wird. Auf der Seite der Kathoden wird die JLU Gießen Mikrostruktur und Architektur von Kohlenstoff/Schwefel-Kompositmaterialien optimal gestalten und mit den sehr leitfähigen und plastisch weichen Ionenleitern der Sulfide/Thiophosphate verknüpfen.
Ein Arbeitsschwerpunkt an der JLU Gießen liegt auf dem grundlegenden Verständnis dieser neuen Zelltechnologie. Die Vermischung von Aktivmaterial, Leitadditiv und Elektrolyt sowie die Porenverteilung werden einen starken Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Feststoffbatterien haben. Das Ziel dieses Teilvorhabens ist es, die optimale Partikelgröße, Porosität sowie Art des Leitkohlenstoffs zu ermitteln. Des Weiteren muss einerseits die Frage geklärt werden, welchen Einfluss das Aktivmaterial (Lithiumsulfid oder Cyclooctaschwefel) auf die Leistungseigenschaften hat.
Andererseits ist es wichtig den Grenzflächenwiderstand und die Ionenleitfähigkeit des Komposits aus stabilem Oxid (Li7La3Zr2O12) und unterschiedlichen Thiophosphat-Elektrolyten aufzuklären, um eine geeignete Kombination der Elektrolyte zu finden. Es ist wichtig, den Spannungsverlauf und die Grenzflächenwiderstände zu verstehen, um hohe Ströme bei niedrigen Überspannungen zu realisieren.
Des Weiteren wird die Volumenexpansion der Elektrodenmaterialien in Feststoffbatterien Auswirkungen auf die Langzeitstabilität haben. Aufgrund der Volumenexpansion und dem steigenden Druck sind die mechanisch weichen Thiophosphate als Elektrolyte geeignet. Weiter sind die elektrochemischen Stabilitätsfenster der Thiophosphate nicht ausreichend untersucht und es ist daher nicht eindeutig welche Elektrolyte eine ausreichende Langzeitstabilität einer LiS-ASB gewährleisten. Es ist daher wichtig den Einfluss unterschiedlicher Thiophosphate auf die Zyklierung, sowie die elastischen Eigenschaften der Komposite aufzuklären. Das abschließende Ziel dieses Teilvorhabens ist der Aufbau einer Festkörper Li-S-Vollzelle die als neues Zellkonzept evaluiert werden wird.
Utilization of the results and contribution to energy storage
Batteriekonzepte wie die hier neu zu untersuchende LiS-ASB bedürfen noch umfangreicher vorwettbewerblicher Forschung im Bereich der Material- und Prozessentwicklung, um die technologische und industrielle Relevanz zu demonstrieren. Um eine qualifizierte Aussage über die Eignung eines neuen Konzeptes für die Elektromobilität zu treffen, müssen sowohl die erreichbaren, realen Energie- und Leistungsdichten auf Zell- und Modul-Ebene als auch die Skalierbarkeit der Synthese auf notwendige Prozessschritte und -methoden hin untersucht werden. Dabei müssen die verwendeten Systeme schon im Labormaßstab unter Berücksichtigung dieser Parameter optimiert werden, um ein sinnvolles Benchmarking mit herkömmlichen Systemen wie Lithium-Ionen-Batterien zu gewährleisten. Diese Art der vorwettbewerblichen Forschung und Entwicklung von neuen Batteriekonzepten ist mit hohem Risiko behaftet, aber für Industrieunternehmen hochinteressant, da eine frühe Identifikation aussichtsreicher Kandidaten einen internationalen Wettbewerbsvorteil verspricht. Der hier skizzierte hybride Ansatz verbindet die Arbeitsfelder Lithium-Metall-Anode (hohe Energiedichte), Li-S (maßgeschneiderte Kathode) und ASB (Festkörperelektrolyt) in einem neuen Zellkonzept – die LiS-ASB – und stellt somit ein potenziell hochrelevantes Batteriesystem für die zukünftige Elektromobilität dar.
Project management as
Justus-Liebig-Universität Gießen
Physikalisch-Chemisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 17
35392 Gießen
DE

Funding

Funding code: 03XP0115A
Sponsor:
Project management agency (governmental):
Profile of funding:
Technologie- und Innovationsförderung
Type of funding:
PDIR
Systematic nature of the performance plan:
KB2220 Li-Ionen-Batterien
This project is part of the joint project
Other sub-projects of the joint project
Sub-project 2
Duration:
01/07/2017 - 31/12/2020
Funding code:
03XP0115B
Forschungszentrum Jülich GmbH
Institute of Energy Materials and Devices (IMD)
Werkstoffsynthese und Herstellungsverfahren (IMD-2)
Wilhelm-Johnen-Str.
52425 Jülich
DE

Sub-project 3
Duration:
01/07/2017 - 30/06/2020
Funding code:
03XP0115C
Technische Universität Berlin
Institut für Werkstoffwissenschaften und -technologien
Fachgebiet Struktur und Eigenschaften von Materialien
Hardenbergstr. 36
Gebäude KPK
10623 Berlin
DE
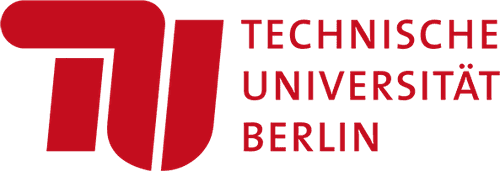
Sub-project 4
Duration:
01/07/2017 - 31/12/2020
Funding code:
03XP0115D
Technische Universität Braunschweig
Braunschweiger LabFactories for Batteries and more
Battery LabFactory Braunschweig
Langer Kamp 19
38106 Braunschweig
DE
This project is part of the funding initiative

Sub-project lead
Justus-Liebig-Universität Gießen
Physikalisch-Chemisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 17
35392 Gießen
DE

Sub-project manager
Press contact
Joint-project management
Justus-Liebig-Universität Gießen
Physikalisch-Chemisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 17
35392 Gießen
DE

