Project
LISZUBA
Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien als Zukunftsbatterie
Duration | 01/07/2017 - 31/12/2020 |
Executing unit | TU Braunschweig • BLB+ • BLB |
City | Braunschweig |
Amount of funding | 331.436,00 € |
Total budget | 331.436,00 € |
Sponsor | BMFTR |
Content description of the sub-project
Brief description
Erstellung eines Benchmark-Systems für Lithium-Schwefel-Zellen
Aufbau einer Charakterisierungsmethodik für Zellen mit Festionenleiterkomponenten
Herstellung von Schwefel-Kohlenstoff-Kompositen
Zerkleinerung von keramischen Festionenleiterpartikeln
Detailed description
Challenges and goals
Das Teilprojekt „Formulierung und Charakterisierung von Kompositmaterialien für Lithium-Schwefel-Festelektrolytkathoden sowie Festelektrolytpartikel für Lithium-Metall-Schutzschichten“ im Rahmen des Verbundprojektes Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien als Zukunftsbatterie (LISZUBA) wird vom Institut für Partikeltechnik (iPAT) und der Battery LabFactory Braunschweig (BLB) bearbeitet. Im Verbundprojekt werden Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien und ihr Potenzial für den zukünftigen Einsatz untersucht. Das Teilprojekt verfolgt im Wesentlichen drei Ziele:
Für die Kathodenseite sollen Kohlenstoff-Schwefel-Komposite mittels reproduzierbarer und skalierbarer Prozesse hergestellt werden, die später mit Festionenleitern versetzt werden können. Zentrale Herausforderungen hierbei sind die Evaluation und Auswahl geeigneter Materialmischungen, Kohlenstoffkomponenten und Prozessstrategien. Die Materialien werden hinsichtlich der wichtigsten Eigenschaften charakterisiert und den Projektpartnern der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) bereitgestellt.
Für die Seite der Anode aus metallischen Lithium sollen im Verbundvorhaben keramische Schutzschichten untersucht werden. Das iPAT wird hierzu seine Kompetenz im Bereich der Zerkleinerung einbringen und keramische Partikel des Projektpartners Forschungszentrum Jülich (FZJ) verarbeiten. Ziel ist hier, die mittlere Partikelgröße in den Nanometerbereich zu bringen, sodass der Sinterungsprozess optimiert wird und die Eigenschaften der hergestellten keramischen Schichten deutlich verbessert werden. Zentrale Ziele des iPAT sind eine effiziente Stabilisierung der Partikel und die Etablierung einer kontinuierlichen Zerkleinerung.
Um die im Verbund hergestellten Materialien zu charakterisieren, werden vom iPAT Referenzsysteme etabliert. Diese bilden den aktuellen Stand der Technik ab und werden benötigt, um die neuen Zellgenerationen in ihrer Leistungsfähigkeit im Vergleich zu anderen Systemen einzuordnen.
Content and focus of work
Im Bereich der Zerkleinerung keramischer Partikel liegt der Arbeitsschwerpunkt auf der Herstellung nanoskaliger Partikel, die stabil in einer Suspension vorliegen. Einerseits wird diese Stabilität benötigt, um die Partikel über längere Zeiträume lagern zu können, andererseits können diese so auch direkt mit dem Prozess der Schichtherstellung verbunden werden. Dies geschieht indem Additive verwendet werden, die später auch für den Folienguss eingesetzt werden. Ein enger Austausch mit den Projektpartnern ist hier von zentraler Bedeutung. Weiterhin wird untersucht, inwieweit sich die Partikel trocken weiterverarbeiten lassen. Neben einer erhöhten Lagerstabilität kann so auch eine trockene Prozessführung abgeleitet werden, um ressourcenschonend ohne Lösemittel arbeiten zu können.
Ein weiterer zentraler Aspekt des iPAT ist das Benchmarking der Zell- und Materialgenerationen. Für den initialen Vergleich werden Schwefelzellen basierend auf flüssigem Elektrolyten assembliert, um einen Leistungsstartpunkt festzustellen. Darauf aufbauend werden schrittweise Festionenleiter integriert und der Einfluss auf die Zellperformance festgestellt. Final wird eine Allfestbatterie assembliert und in ihrer Größe skaliert, sodass die Tauglichkeit der Technologie, auch für größere Systeme, gezeigt werden kann.
Utilization of the results and contribution to energy storage
Das Teilprojekt liefert einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung von Prozessrouten für die Herstellung von Feststoffbatterien. Da sich die Prozesse zur Herstellung von Materialien und Elektroden von denen der klassischen Lithium-Ionen-Batteriezellfertigung teilweise deutlich unterscheiden, sind Untersuchungen zu neuen Prozessrouten von zentraler Bedeutung. Im Fokus stehen dabei Verarbeitungsschritte von bekannten, aber auch neuen Materialien unter Aspekten wie Verträglichkeit mit der Atmosphäre, Adaption der Parametersätze und Skalierbarkeit für die spätere Anwendung. Im Gesamtkontext zur Speicherung von Energie für mobile und stationäre Anwendungen ist dieses Vorhaben von großer Bedeutung.
Es werden zwei wesentlich Punkte bezüglich des Einsatzes neuer Materialklassen adressiert: Schwefel als kathodisches Aktivmaterial mit seiner hohen spezifischen Kapazität, sowie den ökologischen und ökonomischen Vorteilen. Weiterhin wird die Nutzung von Lithium-Metall als Anode mit einer entsprechenden Schutzschicht erforscht, sodass ein stabiler Betrieb einer solchen Elektrodenkonfiguration ermöglicht wird. Mit der skalierten Vollzelle zum Ende des Projektes wird gezeigt, welche Potenziale diese Technologie bietet und mit welchen prozesstechnischen Verfahren man diese Zellbestandteile effizient herstellen kann.
Project management as
Technische Universität Braunschweig
Braunschweiger LabFactories for Batteries and more
Battery LabFactory Braunschweig
Langer Kamp 19
38106 Braunschweig
DE
Funding

Funding code: 03XP0115D
Sponsor:
Project management agency (governmental):
Profile of funding:
Technologie- und Innovationsförderung
Type of funding:
PDIR
Systematic nature of the performance plan:
KB2220 Li-Ionen-Batterien
This project is part of the joint project
Other sub-projects of the joint project
Sub-project 1
Duration:
01/07/2017 - 31/12/2020
Funding code:
03XP0115A
Justus-Liebig-Universität Gießen
Physikalisch-Chemisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 17
35392 Gießen
DE

Sub-project 2
Duration:
01/07/2017 - 31/12/2020
Funding code:
03XP0115B
Forschungszentrum Jülich GmbH
Institute of Energy Materials and Devices (IMD)
Werkstoffsynthese und Herstellungsverfahren (IMD-2)
Wilhelm-Johnen-Str.
52425 Jülich
DE

Sub-project 3
Duration:
01/07/2017 - 30/06/2020
Funding code:
03XP0115C
Technische Universität Berlin
Institut für Werkstoffwissenschaften und -technologien
Fachgebiet Struktur und Eigenschaften von Materialien
Hardenbergstr. 36
Gebäude KPK
10623 Berlin
DE
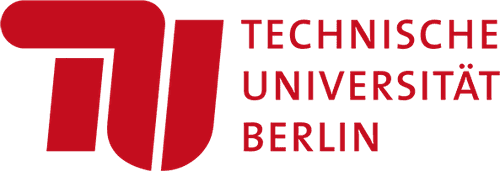
This project is part of the funding initiative

Sub-project lead
Technische Universität Braunschweig
Braunschweiger LabFactories for Batteries and more
Battery LabFactory Braunschweig
Langer Kamp 19
38106 Braunschweig
DE
Sub-project manager
Press contact
Joint-project management
Justus-Liebig-Universität Gießen
Physikalisch-Chemisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 17
35392 Gießen
DE

